Re:Vision – Erfahrungen aus der Zukunft
„Zukunftsstadt Dresden 2030“ prangt auf Plakaten und Bannern. Sie sind garniert mit fluffigen Grafiken einer lokalen Illustratorin. „Visuranto“ hilft beim „Visionieren“ … Wann ist Zukunft? Was ist Stadt? Wie ist Dresden? Und was wird 2030 sein?
Dies ist ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht des Kultur!ngenieurs aus der Zukunft. Besser gesagt: Der Zukunftsstadt. Ich habe mit einem eigenen Projekt an mehreren Workshops der Zukunftsstadt sowie an der Zukunftskonferenz teilgenommen und kenne einige der Menschen, die sie machen oder die an ihr teilhaben. Zum Projekt sage ich nichts, außer dass es in dem schönen Projektkatalog von Katrin Stephan und in diesem Blog umfassend erklärt ist. Was ich verrate: Es hat lange gedauert, bis mir klar war, wie denn nun die Zukunftsstadt funktioniert … und welche Vision sie verfolgt. Diesen Weg der Erkenntnis will ich hier in einer Re:Vision nachzeichnen.
Kurz zu mir: Ich wohne seit 2012 in Löbtau und engagiere mich dort ehrenamtlich als einer von zwei Sprechern der „Löbtauer Runde„. Daher rührt der Kontakt zum lokalen Gewerbeverein Kesselsdorfer Straße e.V. Mit dem zusammen führte die Zukunftsstadt während ihrer Phase 1 am 6. Januar 2016 den Workshop „Nachbarschaft und Wirtschaftsentwicklung im Stadtteil“ durch. Mein erster Kontakt. Zudem mache ich hauptberuflich „Kultur- und Stadtpädagogik„. Aus diesem Umkreis rührt meine Projektidee eines „Lego Campus“ (aus der nach dem Zusammenschluss mit weiteren Projektinitativen City Concierge enstand). Mit der bin ich zur Phase 2 der Zukunftsstadt am 28. April 2017 und 19. Mai 2017 zu den Workshops in der Sparte „Bildung Campus Bürgerwissen“ aufgebrochen. Aus reiner Neugier besuchte ich am 20. Juni 2017 den 2. Workshop der Sparte „Zukunftstadt und Kulturhauptstadt„. Ferner nahm ich mit dem Projekt A17 im Rahmen des Bürgerforums im Kulturpalast am 26. August 2017 an der „Zukunftskonferenz“ teil.
Der Projekttitel „Zukunftsstadt Dresden 2030“ setzt sich aus vier Begriffen zusammen. Deshalb habe ich mich nach meiner Vision von jedem einzelnen gefragt:
Was bedeutet Zukunft?
Was ist in meinen Augen eigentlich „Zukunft„? Derzeit hat sie für mich mit Familie, Beruf und den nächsten paar Jahren zu tun, der Vision von meinem täglichen Leben. Öffne ich aber meinen Blick, geht es um das „Morgen“ – aber wann ist das? Ich weiß: Die jeweilige Folgezeit beginnt quasi in der nächsten Sekunde, und lese: Die „Futurologie“ hingegen entwickelt daraus ganze Zukunftsmodelle, zum Beispiel das nach Pillkahn. In meinen Augen geht es immer auch darum, Neuland zu betreten, also nicht nur um Ideen, sondern auch um Raum. Nicht nur darum, Visionen zu entwickeln, sondern in Anlehnung an den Ursprung des Wortes Zukunft um den hier gar nicht traditionell gemeinten Ad-Vent, sprich das An-Kommen in einer anderen Zeit, einem anderen Raum und das Wohlfühlen darin – mehr vielleicht als heute im Hier und Jetzt einer fragwürdigen politischen Kultur? Ich habe auch nachgesehen, was das viel genutzte „Visionieren“ denn bedeutet: In der Schweiz meint es „sich (einen Film oder Ähnliches) prüfend ansehen„. Womöglich wollen wir uns die „Zukunft“ mal angucken, sie (voraus)sehen. Wir tun also gut daran, ein kritisches Leitbild zu erarbeiten!
Als nächstes frage ich mich: Was evoziert in mir „Dresden„? Tja. Das ist eine sehr persönlich gefärbte Vision: Für mich steht Dresden bis heute unter dem Aspekt der „Hass-Liebe“. Eine in vieler Hinsicht wunderbare Stadt; doch sie hat für mich persönlich tiefe Brüche: Wunden von Bevormundung, freiem Aufstreben, Krieg, erneuter Bevormundung und freiem Markt prägen die hiesige Bürgerschaft – und damit ihr Wirken in allen Bereichen, eben auch der Stadtentwicklung. Sie erkennt ihre Vorzüge oft nicht. Eine von innen unsichtbare Befangenheit gegenüber Veränderungen ist spürbar: „Ach, sie kommen aus Dresden…“, höre ich Menschen andernorts mit bedauerndem Unterton sagen, wenn ich es verrate. Als Reaktion darauf wird nun – man darf es mögen oder nicht – die „Neue Kultur des Miteinanders“ im Kontext der Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 propagiert. Damit ist die Stadt aber noch nicht lebenswerter. Wie kann man Bürgerkultur weiterdenken?
Die Stadt der Zukunft
Da liegt es nahe, mich zu fragen: Was verstehe ich unter „Stadt„? Mir hat sich diese Vision eingeprägt: Eine Stadt ist die Gesellschaft der Menschen und ihrer Häuser. Stadtkultur ist Bürgerkultur. In Dresden gehören die meisten Häuser großen Gesellschaften und nur wenigen echten Bürgern dieser Stadt. „Polis“ nach griechischem Vorbild ist der Ort der Vielen. Wir wissen heute, dass in Griechenland nicht alle mitbestimmen durften. Wir wissen allerdings auch, dass wir heute mehr denn je zu einer geteilten Lebenswelt Stadt in der Lage sind. Die Stadt für Alle. Dresden braucht demnach, finde ich, mehr soziales Rückgrat unter seinen Bürgern, mehr Eigentum, Selbstestimmung und Aufrichtigkeit. Einige Stadtteile gehen beispielhaft mit Bügerinitiativen und Stadtteilvereinen voran. In der Zukunftsstadt wird etwa das Etablieren stadtweiter Stadtteil- und Quartiersmanager mit jeweils eigenen Bürgerfonds diskutiert. Nicht „Smart City“, sondern „Urban Commoning“!
Zuguterletzt bleibt deshalb die Frage: Und was steckt für mich in der Zahl „2030„? Ich werde in dem Jahr 52 Jahre alt. Ungefähr Bergfest. Ob ich da noch in Dresden oder woanders bin – mal sehen. Die Welt könnte jedenfalls anders aussehen. Das ist in zwölf Jahren; vor zwölf Jahren hatte ich gerade mein erstes Handy und war erst seit drei Jahren auf dem eigenen Computer unterwegs. Wir könnten eine Welt mit sachlichen und fachlichen Bürgervertretungen haben, wo der Bauer auf der nächsten Brache wohnt und Brachen kulturell akzeptiertes Revitalisierungsland sind, in der Autos ein schlechter Witz unserer Großeltern und Eltern sind und Digitalisierung ein wichtiger, aber manchmal peinlicher Zwischenschritt der Evolution in unserer Jugendzeit. Wir wären nachhaltig, ohne es so zu nennen. Wir lebten in einer Vision der Kommunalität.
Auch ein auf Nachhaltigkeit und Basisdemokratie angelegtes Projekt braucht einen Projektmanager. Ich hatte meinen Kollegen Norbert Rost am Beginn von Phase 1 in E-Mails und Gesprächen um ein Erläutern der Zukunftsstadt als solcher und ein Vorstellen derselben in der Löbtauer Runde gebeten. Seine Vision – meine einfache Idee: einen Workshop aus der Löbtauer Bürgerschaft heraus im Zentrum des Stadtteils und im Rahmen der Zukunftsinitiative anzubieten. Das kam dann erst auf dem Umweg über den oben genannten Gewerbeverein zustande, leider an einem abgelegenen Ort, mit geringem Zuspruch. Der 2017 gegründete Löbtop e.V. führt den Ansatz in Form der Ideenwerkstatt künftig fort.
An dem Punkt stellte ich mir zum ersten Mal die Frage nach dem Praxis-Nutzen des kommunalen, auf Beteiligung angelegten Projektes. Offenbar kamen Aufwand und Nutzen nicht immer in ein günstiges Verhältnis. Mitbestimmung war von Anfang an abhängig von einer besonderen Gunst des Moments. Unsere Eigenmotivation wurde nicht unbedingt mit Zuspruch quittiert.
Schwierigkeiten und Herausforderungen
In Phase 2 sind nun in acht Sparten seit Januar 2017 zirka 100 Projektideen entstanden. Sie werden bis Juni 2018 ausgearbeitet. Das Projektteam hat sicher alle Hände voll zu tun und die Projektpartner sind gewiss enorm herausgefordert, die zum Teil populärwissenschatlichen Bürgerinhalte in wissenschatliche und förderrechtliche Formulierungen zu übersetzen, lesbar zu machen, ohne dabei die zumeist kreativen und motivierten Projekte zu verflachen. Die vielen Akteure mit ihren unterschiedlichsten lebensweltlichen Meinungen und Projektionen erwarten ein professionelles Fördern, wollen echte Multiplikatoren finden. Zugleich können bisher weder Inklusion, noch ein wertschätzendes Berücksichtigen aller erdachten Projekte garantiert werden. Kann soziales Gestalten hier als visionäre Sinnbrücke fungieren?
Die Welt der Ideen und die Welt der Dinge wollen verbunden werden. Mit dem Wort Zukunft wurde im Mittelhochdeutschen auch die religiöse Dimension des „Herabkommens Gottes“ beschrieben. Weltlich betrachtet, könnten sich in so einem Prozess wie der Zukunftsstadt aus der weiten Welt der Ideen also konkrete Maßnahmen materialisieren.
In meinen Augen und nach meinen Erfahrungen ist dieser Prozess nicht nur neudeutsch „Citizen Science„, also das gemeinsame Wirken von Bürgerschaft und Wissenschaft an (hoffentlich) sozialen Produkten. Ich sehe darin auch klar „Community Design“, ein gemeinsamer Gestaltungswille, die Vision von einem Zusammenleben. Digitale und soziale Medien bilden heute die Grundlage für eine breite kommunale Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden, auch der Kommune selbst. Diese sollten alle Beteiligten wertschätzen und fördern. Denn Beteiligung auf, an und in allen Ebenen des urbanen Lebens macht den viel geforderten Gemeinsinn aus, der heute angeblich fehlt. In der Psychologie des Lernens spricht man von Flow und Eigenmotivation. Gemessen an den aufrichtigen Beiträgen der Teilnehmenden sollte das Programm Zukunftsstadt genau diese Eigenschaften der Akteure bewusst stärken und deren Selbstorganisation fördern. Für mich bedeutet das vor allem: Ein intrinsisches (eigenmotiviertes) Clustern, also behutsam moderiertes Zusammenführen der vielen wertvollen und teils benachbarten Projektideen zu einer gemeinsamen und gemeinsam gelebten Vision statt eines nun schon aufkeimenden extrinsischen (fremdmotivierten), von mehr oder minder selbstbewussten Akteuren angetriebenen Wettbewerbs zwischen Projekten – leider nur um Geld und nicht die lebendige Vision: Die immer wieder beschworenen, sagenhaften eine Million Euro für Phase 3.
Und hier muss ich – zumindest in Teilen – das Fehlen der Profis in Pädagogik und Moderation, aber auch der dafür benötigten Mittel anmerken. Es reicht nicht, komplexe Dinge und Leute mit einem vergleichsweise kleinen Projektteam und ohne fundierte Fachexpertise zusammenzubringen. Wenn wir wollen, dass die Zukunft in Dresden anders als heute aussieht, dann müssen wir sie anders als heute angehen. Wir müssen den üblichen „Sand im Getriebe“ kultureller Ideenfindung mit Leitbildern abschmieren, die runter gehen wie Öl. Mit echten Visionen schon in der Konzeption: Da sind dann Kinder und Jugendliche genauso inkludiert wie Menschen mit Behinderungen oder noch weniger kategorisierbaren Nachteilen. Und da sind Dolmetscher für kulturelle Sprachhürden alltägliche Wegbegleiter und nicht die, die auf der Bühne neben dem Redner stehen. Da sind alle Beteiligten Visionäre. Und alle auf der Bühne der Vision.
Dieser Gastbeitrag stammt von Felix Liebig. Er beschäftigt sich beruflich mit „frischen Ideen und Techniken für nachaltige Kultur“. Weitere Details erhaltet ihr unter kulturingenieur.com.
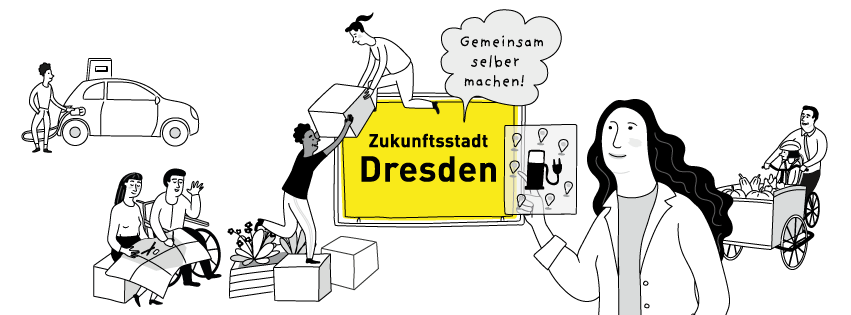
 # DD2030
# DD2030


Schreibe einen Kommentar